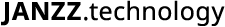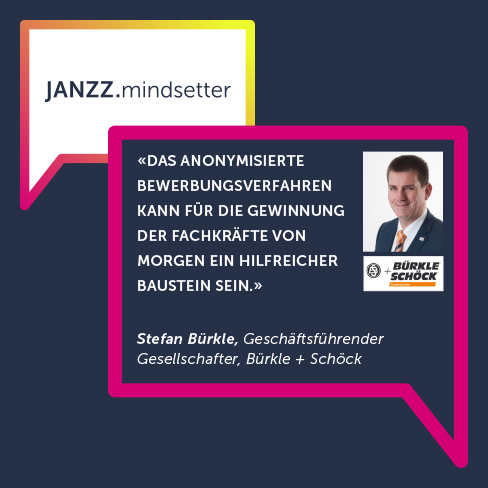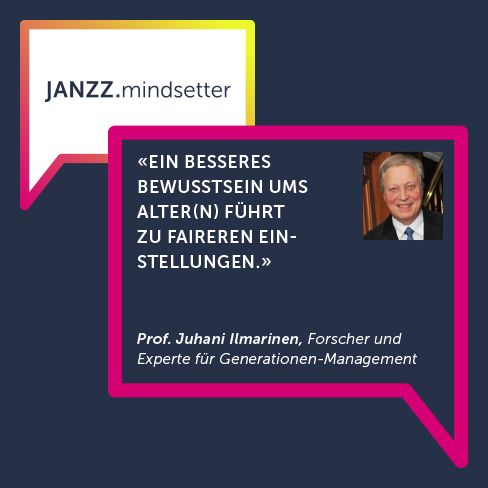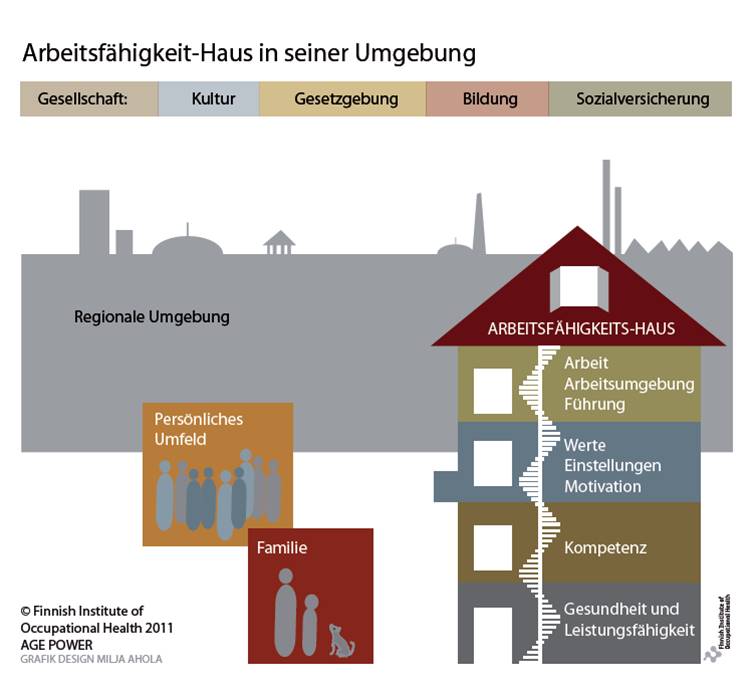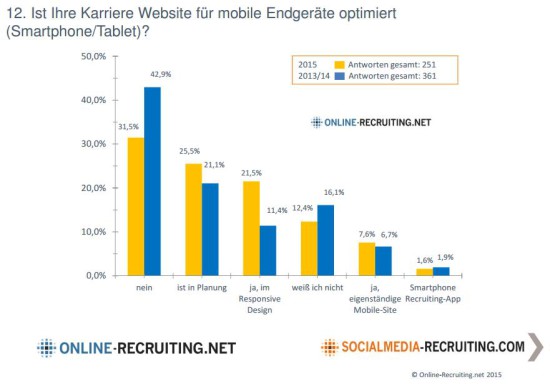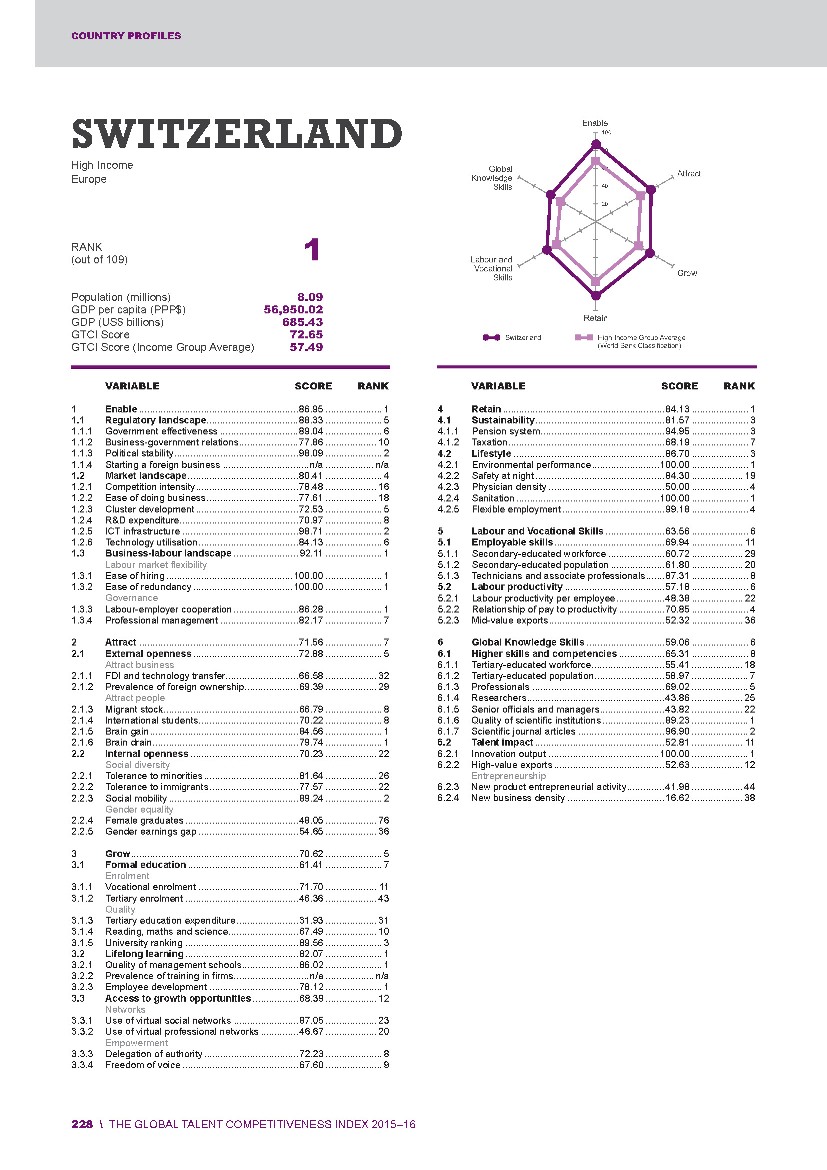Die digitale Revolution hat das HR und auch das Recruiting bereits seit geraumer Zeit erfasst, ja vielleicht sogar teilweise überschwappt. Denn wie der Web Service Capterra eindrücklich aufzeigt, gibt es eine immer grössere Vielfalt an HR-Anwendungen: Rund 547 HR-Softwareprodukte in 17 unterschiedlichen Kategorien listet der Onlinedienst auf. Da gibt es von Zeitmanagement, über Performance Ratings bis zu Talent Management so ziemlich für jede Aufgabe im HR eine passende Software-Lösung. Doch viel wichtiger als die Menge wäre der richtige Einsatz, damit aus Technologie, die Ihnen helfen sollte gewisse Schritte zu automatisieren, nicht noch mehr Aufwand resultiert. Wir möchten uns in diesem Blog auf die Automatisierung im Bewerbungsprozess beschränken.
Trotz all der Automatisierung können wir aber das Duell Mensch gegen Maschine schon vorentscheiden. Ohne Mitwirkung des Menschen wird es und soll es nicht gehen. Fakt ist aber, dass bereits heute die richtigen Technologien und Tools das HR und das Recruitment gewinnbringend unterstützen und damit die Transformation zu einer weiterreichenden Automation initiiert haben. Genau zu diesem Thema, mit dem Schwerpunkt auf die Bewerbungsverfahren, hat die Zeit ein höchst interessantes Interview mit Christoph Beck, Professor an der Hochschule Koblenz für Human Ressource Management, geführt. Wir möchten in diesem Blog gewisse Fragen aus dem Interview herausnehmen und diese noch ergänzen, respektive aus unserer Sicht kommentieren.
Thema Bewerbungsmanagementsysteme
ZEIT Campus: Mit solchen Systemen können Bewerber automatisch vorsortiert werden, zum Beispiel in eine A-Gruppe mit vielversprechenden Kandidaten, eine B-Gruppe, aus der man Nachrücker rekrutiert, und eine C-Gruppe für Bewerber mit geringen Aussichten.
Beck: Im Grunde ist das nichts Neues, nur dass es früher Menschen gemacht haben. Wenn für eine Stelle viele Bewerbungen eingingen, wurde bei der Erstsichtung pro Mappe nicht mehr als eine Minute verwendet. Dabei hat man auf dieselben Schlüsselkriterien geachtet, die auch jetzt herangezogen werden.
ZEIT Campus: Welche Kriterien sind das?
Beck: Das kommt auf das Unternehmen und auf die Stelle an. Meist geht es um ganz grundlegende Dinge wie zum Beispiel den Studienabschluss und bestimmte Fähigkeiten wie etwa Sprachkenntnisse. Das Anforderungsprofil der Stelle wird mit dem Bewerberprofil abgeglichen. Personaler sprechen von der sogenannten Matching-Qualität. Sie sollte möglichst hoch sein.
ZEIT Campus: Ein Beispiel, bitte.
Beck: Wenn man einen Anästhesisten sucht, will man keinen Orthopäden. Wenn jemand fließend Englisch sprechen muss, weil er mit Kunden in New York verhandeln wird, reicht es nicht, wenn er das nur mäßig kann, dafür aber perfekt Spanisch beherrscht. Und wenn man für eine Stelle Erfahrungen im Projektmanagement mitbringen soll, ist es nützlich, wenn man so etwas schon einmal gemacht hat. Die Fähigkeiten, die man braucht, um den jeweiligen Job gut zu machen, sollten also so stark wie möglich mit dem zusammengehen, was der Bewerber mitbringt. Diese sogenannte Passung ist einfach enorm wichtig, damit der Bewerber hinterher im Berufsalltag gut zurechtkommt.
Herr Beck nennt eine der wichtigsten Punkte überhaupt: die Matching-Qualität. Diese stellt heute bei vielen automatisieren Prozessen ein sehr grosses Problem dar. Denn Mismatches sorgen für einen höheren Aufwand seitens der Personaler oder je nachdem auch dafür, dass geeignete Bewerber aussortiert werden. Joachim Diercks von Cyquest hat in unserer Interview-Serie JANZZ-Mindsetter die Problematik präzis ausgeführt: „Gutes Matching sorgt ja dafür, dass es weniger Friktionen gibt. Friktionen sind die Ineffizienzen, die bei der Suche nach passendem Kandidaten bzw. der Suche nach dem passenden Job und Arbeitgeber entstehen. Dieser gegenseitige Suchprozess kostet im günstigsten Fall nur Zeit und Energie auf beiden Seiten; im schlimmsten Fall jedoch kostet er sowohl viel Zeit und Energie und gelingt am Ende noch nicht einmal, weil Kandidat, Job und Unternehmen gar nicht zusammen passen – ein Fehler, der leider oft erst im Nachhinein erkannt wird oder sogar gar nicht. Das eine wäre ineffizient, das andere zudem auch noch ineffektiv.“ Genau dort liegt somit auch die grösste Gefahr der Bewerbungsmanagementsysteme zu scheitern und somit auch, dass die Unternehmen der Auswahl durch einen Algorithmus oder wie es die Zeit nennt Maschine zu vertrauen. Dabei ist der erste grosse Fehler oftmals der falsche Einsatz von Technologie. Denn Matching ist nie gleich Matching und erst, wer die Unterschiede wirklich gut kennt, kann diese auch wirklich erfolgreich und vor allem gewinnbringend einsetzen. Es gibt zwei Varianten von Matchings, doch nur eines ist wirklich wirkungsvoll.
Keywordbasiertes Matching/Search
Die keywordbasierte Suche ist die einfachste Form der Suche in grossen Datenmengen. Basis der Suche bildet das eingegebene Keyword, welches dann ohne Berücksichtigung von Bedeutung, Kontext und Synonymen abgeglichen wird. Es ist offensichtlich, dass dies nicht funktionieren kann, oder nur zu einem gewissen Grad. Denn viele Wörter können je nach Kontext komplett unterschiedlich verwendet werden. Das Wort «Manager» ist ein gutes Beispiel für solche Auswüchse: «Sales Manager», «Campaign Manager» und «Office Manager» tauchen alle bei der gleichen Suche auf, haben aber schlichtweg nicht viel miteinander zu tun.
Zudem erkennt die keywordbasierte Suche keine Synonyme oder Bezeichnungen in anderen Sprachen: so sucht sie neben dem «CEO» nicht auch z. B. nach «Geschäftsführer/-in», «Geschäftsleiter/-in» oder «Managing Director» etc. Dafür findet sie Fehltreffer wie z. B. «Assistentin des CEO» oder «Sekretärin des Geschäftsführers». Die keywordbasierte Suche übersieht somit viele potenzielle Resultate und liefert derweil zahlreiche falsche Treffer, was nicht nur Zeit sondern auch Nerven kostet. Damit die keywordbasierte Suche besser funktionieren kann, braucht sie einen Thesaurus, der ihr hilft den richtigen Kontext und passende Zusammenhänge zu erkennen. Damit wären wir aber schon fast beim ontologiebasierten Matching.
Ontologiebasiertes Matching/Search
Das ontologiebasierte Matching stellt nicht den Suchbegriff als solchen, sondern dessen Bedeutung in den Vordergrund. Dies geschieht über einen Thesaurus (Wortnetz) und eine Ontologie (Datenbank). Dort sind die Begriffe nach Bedeutung gruppiert. Bei der Suchabfrage werden so Begriffe nach der korrekten Bedeutung miteinander verknüpft, auch wenn diese nicht mit der «Zeichenkette» übereinstimmen. Zudem werden bei Suchabfragen auch Synonyme und falls gewünscht, auch Bezeichnungen und Begriffe aus anderen Sprachen miteinbezogen. So erscheinen neben dem «Doktor» auch z. B. «Arzt/Ärztin», «Mediziner», «physician» etc. aber keine Fehltreffer wie z. B. «Doktorand/in» (PhD-Student/in) oder «Arzthelfer/in» etc. Der von Herrn Beck genannte klassische Mismatch, kann so also verhindert werden, aber es kann noch mehr.
In den letzten Jahren sind sehr viele, auch traditionelle Berufe z. B. mit allenfalls zeitgemässeren, aber oft im Sprachgebrauch sperrigen und daher kaum benutzten neuen Benennungen versehen. So wurden in den letzten Jahren z. B. aus einem «Mitarbeitenden für Kopien und Archiv» ein «Executive Document Manager» oder aus der «Reinigungsfachkraft» auch einmal eine «Raumveredlerin», um nur einige seltsame Auswüchse heutiger Job- und Berufsbeschreibungen zu nennen. Die ontologiebasierte Suche erkennt beide Ausdrücke, stellt problemlos den Zusammenhang her und kann so die Anzahl der richtigen Suchresultate maximieren.
Eine solche Form des Matchings wird oftmals auch als semantische Suche bezeichnet. Die Ergebnisse und die Präzision von semantischen Such- und Matchingprozessen sind von Umfang und Tiefe, aber natürlich auch von der Qualität und Vollständigkeit des verwendeten Kontext- und Hintergrundwissens, bzw. der verwendeten Ontologie abhängig.
Zukunft: ontologiebasiertes Matching
Sicherlich wird die ontologiebasierte Suche die zukunftsweisende Form sein, weil sie schlicht und einfach viel mehr kann. Denn sie verknüpft Inhalte und nicht Worte, was die Basis für eine erfolgreiche Suche ist. Wer zukünftig auf die ontologiebasierte Suche setzt, wird sich viel Zeit mit dem Durchforsten von unpassenden Suchresultaten sparen. Denn es wird ihm nur noch das Resultat angezeigt, dass auch wirklich inhaltlich zu seiner Suche passt. Ein solches Matching ist aber nicht einfach nur Zukunftsmusik, sondern es könnte bereits heute in Ihrer Firma eingesetzt werden. Sei es als eigene Jobplattform oder eben integriert in ein Bewerbungsmanagementsystem. Sie müssen dafür auch nicht extra eine ganze IT-Abteilung neu aufbauen. Es gibt bereits eine Ontologie, die Sie einsetzen können.
JANZZon! Die einzigartige, mehrsprachige und umfassendste Ontologie. Weltweit.
Über das JANZZrestAPI können Sie die SaaS-Lösung JANZZon!, die heute grösste, mehrsprachige enzyklopädische Wissensdatenbank im Bereich Occupation Data (insbesondere Berufe, Berufsklassifikationen, Fähigkeiten/Kompetenzen, Ausbildungen/Qualifikationen etc.) für Ihre Anwendungen nutzen. Für den Aufbau der Datenbank wurden bereits über 48‘000 Stunden eingesetzt und sie wird jeden Tag weiter aufgebaut. Über alle Sprachen umfasst JANZZon! bereits über 21 Millionen Begriffe, davon über 120‘000 Berufe/Tätigkeiten und über 166‘000 Kompetenzen und Fähigkeiten. Diese Ontologie können Sie bereits heute als Cloudlösung einsetzen.
Vorteile und Gründe für den Einsatz von JANZZon! als Cloud-Lösung.
Mit JANZZon! setzen Sie auf eine sichere, nachhaltige und kosteneffiziente Cloud-Lösung, die Ihnen trotzdem fast alle Optionen für die gewünschten Anwendungen und Einsatzgebiete ermöglicht. Zudem profitieren Sie vom «Wisdom of crowds», von den vielen anderen Nutzern von JANZZon! in unterschiedlichen Sprachen, Branchen und Fachgebieten. Und von deren laufenden Anreicherungen, Updates und Aktualisierungen. Ohne selbst dafür meist umfangreiche Ressourcen bereitstellen zu müssen. Alles innerhalb klar strukturierter Preispläne und abgestimmt auf das Volumen und den Umfang Ihrer Nutzung. Überzeugen Sie sich gleich selbst und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Präsentationstermin.